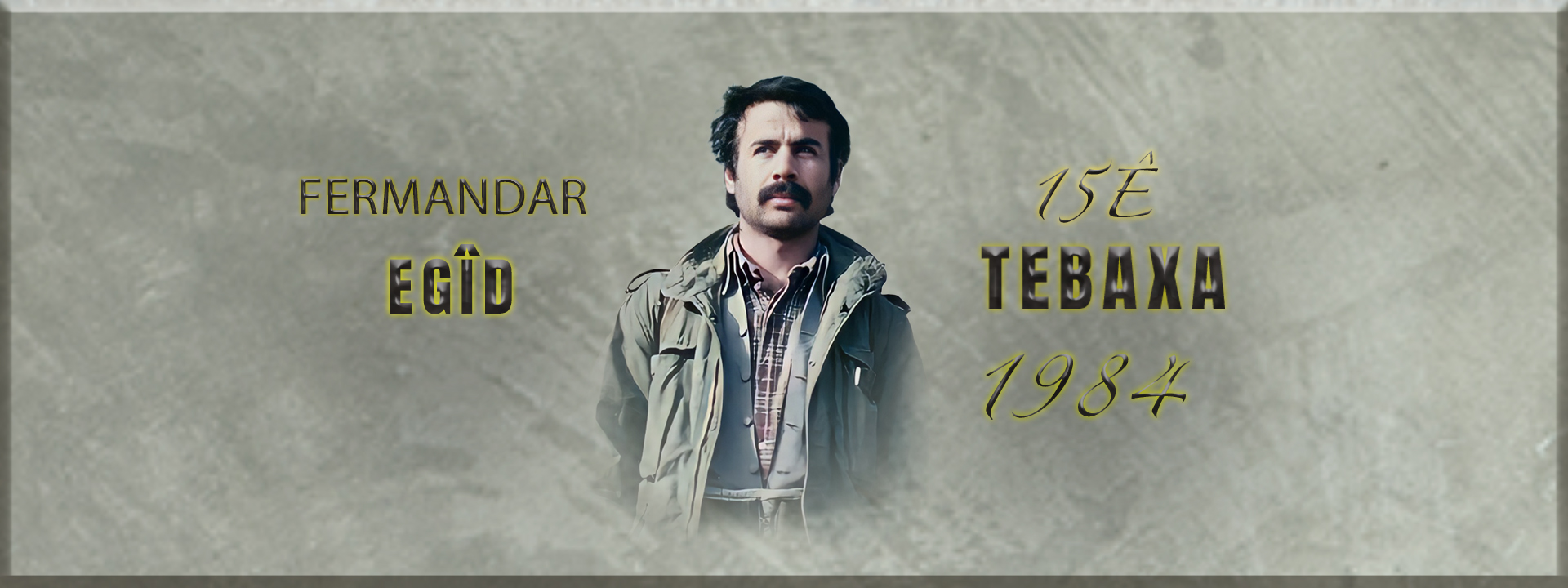„Wie der Nationalstaat die Waffe des Kapitalismus ist, so ist die Kommune das konstituierende Prinzip der Völker.“ – Abdullah Öcalan vertiefte seine Kommunenphilosophie besonders nach 2000 und machte sie zum Grundpfeiler eines zeitgemäßen Sozialismus.
Die Entwicklungen nach der ERNK-Erfahrung zeigten, dass der Prozess tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen in Kurdistan ungebrochen anhielt. Es sei an dieser Stelle betont: In einem Land wie Kurdistan – einer Region, die historisch stets unterdrückt, geplündert und in der die ansässigen Völker systematisch Opfer von Genoziden wurden – ist der Aufbau eines neuen gesellschaftlichen Lebens keine Aufgabe, die sich innerhalb weniger Jahre vollziehen lässt. Die kurdische Befreiungsbewegung und Abdullah Öcalan waren sich dieser historischen Realität bewusst, als sie mit dem, was Öcalan als eine „Intervention in eine kopfstehende Geschichte“ bezeichnete, erste Schritte zur Umkehr des bisherigen Verlaufs der Geschichte unternahmen. Doch durch eine strategisch konsequente Herangehensweise gelang es, innerhalb von nur fünf Jahrzehnten fundamentale Veränderungen in Gang zu setzen.
Öcalans Worte – „Wir haben die Aufgabe übernommen, Patriot:innen eines Landes zu sein, dessen Name nicht einmal auszusprechen man sich traute“ – spiegeln eindrucksvoll die Größe und Schwierigkeit dieses Unterfangens wider. Mit der Überzeugung, dass „ohne große Utopien keine großen gesellschaftlichen Praktiken entstehen können“, entwickelte Öcalan von Beginn an ein vorausschauendes Denken, das seine politische Praxis stets an langfristigen Zielen orientierte. Diese Haltung prägte nicht nur seine eigene Entwicklung, sondern auch die der kurdischen Freiheitsbewegung insgesamt.
Nach dem Jahr 2000 setzte eine Phase ideologischer Weiterentwicklung ein, in der Öcalan begonnene Konzepte überdachte, bestehende Lücken schloss und neue Ansätze formulierte. Im Zentrum dieser Erneuerung standen die kommunale Organisierung und die Neubewertung der Rolle der Kommune im sozialistischen Verständnis der Freiheitsbewegung. In Auseinandersetzung mit den Wandlungsprozessen der Welt und einer sich verändernden historischen Realität übte Öcalan scharfe Kritik an klassischen sozialistischen Organisationsmodellen und am realsozialistischen beziehungsweise wissenschaftlich-sozialistischen Paradigma. Im Zuge dieser Auseinandersetzung entwickelte er eine neuzeitliche Vorstellung von Sozialismus – mit einer entsprechend erweiterten und vertieften Definition der Kommune.
Der Staat als Hindernis – Kommune als Alternative zum realsozialistischen Modell
Seit den 1990er Jahren argumentiert Öcalan für ein staatsfreies Verständnis von Sozialismus. In zahlreichen Schriften stellt er klar, dass die Fixierung auf staatliche Strukturen eine der größten Hürden auf dem Weg zum Aufbau eines demokratischen Sozialismus darstelle. Vielmehr liege die zentrale Organisationsform des Sozialismus – oft übersehen und unterschätzt – in der Kommune.
In einer Analyse schreibt er dazu:
„Wir wollen keinen Staat. Wenn wir einen wollten, würden wir wie im Irak bis zum Äußersten gehen. Aber es geht uns nicht um Grenzen oder Ministerposten wie im Irak. Was wir fordern, ist, dass der Demokratisierungsprozess unseres Volkes in den Stadtteilen, Dörfern und Städten nicht behindert wird. Und das nicht nur für die Kurd:innen – der demokratische Konföderalismus ist für die gesamte Türkei ein realistischeres Modell. Ich spreche nicht von einem Bruch mit der unitären Struktur. Es geht nicht um den Staat, sondern um die Art und Weise, wie die Gesellschaft darunter ihre eigene Demokratie organisiert und lebt. Die Kurd:innen können dieses System in allen Teilen Kurdistans anwenden und weiterentwickeln.“
Als praktisches Beispiel für diese Überlegungen verweist Öcalan konsequent auf die Erfahrungen in Rojava.
In einer weiteren Analyse kritisiert er das zivilisationsgeschichtliche Narrativ, das die Stadt als Zentrum historischer Entwicklung begreift:
„Die Geschichte wurde als Erzählung einer Zivilisation rund um die Stadt geschrieben. Vor der Industrialisierung existierte ein gewisses Gleichgewicht zwischen Stadtleben und agrarischer Dorfgesellschaft. Auch wenn es Spannungen gab, nahmen sie nie ein Ausmaß an, das den gesellschaftlichen Zusammenhang gefährdete. Es herrschte eine wechselseitige Abhängigkeit, ein Prinzip gegenseitiger Versorgung. Die strukturelle, profitorientierte Explosion des Industrialismus hat dieses Gleichgewicht nicht nur zerstört – sie hat in den letzten zwei Jahrhunderten mit einer abnormen Urbanisierung eine Art städtischer Entmenschlichung hervorgebracht. Durch die Zerstörung der bäuerlich-dörflichen Gesellschaft unter dem Namen einer sogenannten ‚Industriegesellschaft‘ ist ein krebsartiges Gebilde entstanden, das fälschlich als Fortschritt gilt. Was als ‚Explosion der Mittelschicht‘ bezeichnet wird, ist in Wahrheit eine vollkommen funktionslose Erscheinung.“
Mit dieser Kritik stellt Öcalan nicht nur ein dominantes Geschichtsverständnis infrage, das die Kommune marginalisiert oder ausblendet – vielmehr definiert er die Kommunalisierung als zentralen Weg gesellschaftlicher Organisierung und Befreiung.
„Ohne Gesellschaft gibt es kein Individuum
Zur Bedeutung der Kommunalisierung und eines gemeinschaftlichen Lebens führt Öcalan aus:
„Der Bürger der demokratischen Nation ist zugleich frei und gemeinschaftlich. Das vom Kapitalismus gegen die Gesellschaft aufgehetzte angeblich freie Individuum verkörpert in Wahrheit die tiefste Form der Versklavung. Die liberale Ideologie erzeugt jedoch das Bild, als verfüge das Individuum über grenzenlose Freiheiten. Tatsächlich aber repräsentiert der lohnabhängige, zum hegemonialen Prinzip erhobene Arbeiter – als Träger der nie zuvor erreichten Maximalprofitlogik – die fortgeschrittenste Form der Versklavung. Dieser Typ Mensch wird durch die gnadenlose Erziehung und Lebenspraxis des Nationalstaates produziert. Da sein Überleben an die Herrschaft des Geldes gebunden ist, wirkt das Lohnsystem wie ein Halsband, das jeden beliebig in eine bestimmte Richtung zwingt – denn es gibt keinen anderen Weg zu leben. Wählt jemand den Ausstieg, also Arbeitslosigkeit, gleicht dies einem Sterben auf Raten. Der kapitalistische Individualismus basiert zudem auf der Leugnung der Gesellschaft. Er glaubt, sich nur verwirklichen zu können, indem er Geschichte, Tradition und alle gesellschaftlichen Werte negiert. Genau hierin liegt die zentrale Täuschung der liberalen Ideologie. Ihr Leitspruch lautet: ‚Es gibt keine Gesellschaft, nur das Individuum.‘ Doch Kapitalismus ist ein krankhaftes System, das auf der Zerstörung der Gesellschaft beruht.“
Durch solche Aussagen macht Öcalan deutlich, dass die Kultur der Kommune für ihn untrennbar mit individueller Befreiung, ethisch-politischer Haltung und gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist. Gleichzeitig grenzt er sich von staatszentrierten und autoritären Ausprägungen des realsozialistischen Modells klar ab.
Dem kapitalistischen Angriff auf gesellschaftliche Beziehungen, der ökonomischen Reduktion des Menschen und der Herausbildung neuer Abhängigkeitsverhältnisse stellt Öcalan die Vorstellung entgegen, dass mit der Kommunalisierung auch die Gesellschaftlichkeit wiederhergestellt wird. Der Mensch könne nur als gesellschaftliches Wesen – frei, ethisch fundiert und politisch verantwortungsbewusst – existieren.
Aus dieser Perspektive sind Kommunen nach Öcalan kein Zusammenschluss einzelner Gruppen, sondern Orte, an denen unterschiedliche Teile der Gesellschaft gemeinsame Werte und Entscheidungen entwickeln. Sie bilden damit nicht eine klassische Kommune im historischen Sinne, sondern einen Grundbaustein eines erneuerten Sozialismusverständnisses.
Die Kommune und die Idee der verhandelnden Demokratie
Öcalan beschreibt in seinem Manifest der demokratischen Zivilisation:
„Das historisch beispiellose Modell ist der monopolistische, homogene Nationalstaat. Dessen unmenschlichen und gewaltsamen Charakter haben wir umfassend analysiert. Demgegenüber ist eine offene, flexible Konföderation demokratischer Nationen, die auf vielfältigen Identitäten basiert, nicht nur historisch und gesellschaftlich sinnvoll, sondern stellt zugleich das Ideal dar. Diese Konföderation ist nicht als Staatenbund zu verstehen, sondern als Zusammenschluss demokratischer Kommunen. Demokratische Kommunen bilden die Verwaltungseinheiten innerhalb der jeweiligen Gesellschaften. In ihnen können demokratische Prinzipien am konsequentesten verwirklicht werden. Sie sind das vollendetste Beispiel einer demokratischen Gesellschaftsordnung.“
In seiner jüngsten Botschaft an die kurdische Frauenbewegung TJA bezeichnet Öcalan die verhandelnde bzw. dialogische oder deliberative Demokratie als grundlegendes Prinzip dieser kommunalen Ordnung. Kommunen seien keine Machtinstrumente einer einzelnen Gruppe, sondern Räume, in denen jede gesellschaftliche Gruppe sprechen, entscheiden und Verantwortung übernehmen könne. Damit wird Ausgrenzung vermieden und ein inklusives Verständnis von politischer Teilhabe verwirklicht.
In diesem Sinn ähneln Kommunen dem von Marx beschriebenen Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten“: Sie funktionieren ohne herrschende Klasse; alle übernehmen Aufgaben und tragen gemeinsam das Fortbestehen der Kommune.
Das horizontale Organisationsmodell als Grundstruktur der Kommune
Eine Struktur, an der alle Menschen teilhaben, darf ihrer Natur nach keine vertikale Hierarchie oder ein Oben-und-Unten-Verhältnis aufweisen. Die Notwendigkeit einer solchen Struktur ergibt sich auch aus der historischen Erfahrung: Nach dem Scheitern des Realsozialismus und der ideologischen Vorherrschaft des liberalen Demokratieverständnisses – das als vermeintlich „einzige Wahrheit“ und „Endpunkt der Menschheitsgeschichte“ präsentiert wurde – entwickelte sich in den sich wandelnden globalen Bedingungen ein neuer Ansatz für den Übergang zum Sozialismus: die verhandelnde Demokratie.
Diese Demokratieform beruht auf einem horizontalen Organisationsprinzip, das eine klare Absage an hierarchische Machtverhältnisse beinhaltet. In diesem System werden Repräsentant:innen von allen Teilen der Gesellschaft gewählt – und können bei Bedarf wieder abgewählt werden. Das horizontale Organisationsmodell bildet einen der zentralen Bausteine der kommunalen Selbstverwaltung. Entscheidend ist dabei, dass jede Kommune alle Menschen in ihrem Wirkungsbereich einschließt und jedem Individuum das Recht auf Mitsprache einräumt.
Ein Mensch, der sprechen kann und dessen Wort Bedeutung hat, bildet das Fundament einer organisierten und freien Gesellschaft. Ein System, in dem es keine autoritären Vorgaben nach dem Motto „Ich habe es gesagt, also gilt es“ gibt, kann – auf richtiger Grundlage aufgebaut – zur Befreiung des Individuums führen und damit zur Herausbildung freier Gesellschaften. Dies wiederum ebnet den Weg für eine neue sozialistische Perspektive.
Unabhängigkeit vom Staat und die Ökonomie der Kommune
Kommunale Strukturen müssen unabhängig vom Staat agieren. Nur so können sie sich auf die spezifischen lokalen Bedingungen einstellen und diese auf der Grundlage demokratischer Lebenspraxis gestalten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Selbstständigkeit betrifft auch die ökonomische Organisation.
Öcalan betont wiederholt, dass die Kommune nicht nur eine politische, sondern auch eine wirtschaftliche Organisationsform ist. In seinen Worten:
„Die elementaren Einheiten der Ökonomie sind die Kommunen. Weder die in kleinste Einheiten – etwa bis auf Familienebene – aufgeteilte Eigentumsform von Boden und Produktionsmitteln, noch deren Konzentration in den Händen großer Konzerne ist wirtschaftlich sinnvoll. Beides sind Instrumente moderner Zivilisation, die die Wirtschaft letztlich zerstören. Das Ideal ist die gemeinschaftliche Verfügung über Boden und Produktionsmittel, orientiert an maximaler Nützlichkeit und Effizienz für die Gesellschaft. Die Frau – historisch aus der Ökonomie ausgeschlossen – ist in Wahrheit deren eigentliche Schöpferin. Frau und Wirtschaft gehören zusammen wie Fleisch und Knochen. Da in der kommunalen Ökonomie für grundlegende Bedürfnisse produziert wird, kennt sie weder Krisen noch Umweltverschmutzung oder Klimazerstörung. Der Moment, in dem die Produktion aufhört, profitorientiert zu sein, markiert den Beginn der Rettung der Welt – und damit die Befreiung von Mensch und Leben.“
Die Kommune als umfassende gesellschaftliche Neustrukturierung
In Öcalans Verständnis ist die Kommune kein punktuelles oder rein funktionales Organisationsmodell. Vielmehr soll sie alle Lebensbereiche erfassen und neu ordnen. Das Ziel besteht darin, ein neues gesellschaftliches Leben zu etablieren, das auf bewusster Partizipation basiert und die politische Bildung der Massen im Sinne eines demokratischen Sozialismus fördert. Die Kommune – verstanden als Raum verhandelnder Demokratie – ist damit ein zentrales Übergangsinstrument auf dem Weg zum Sozialismus unserer Zeit.
Fortsetzung folgt in Teil 5 der Artikelreihe