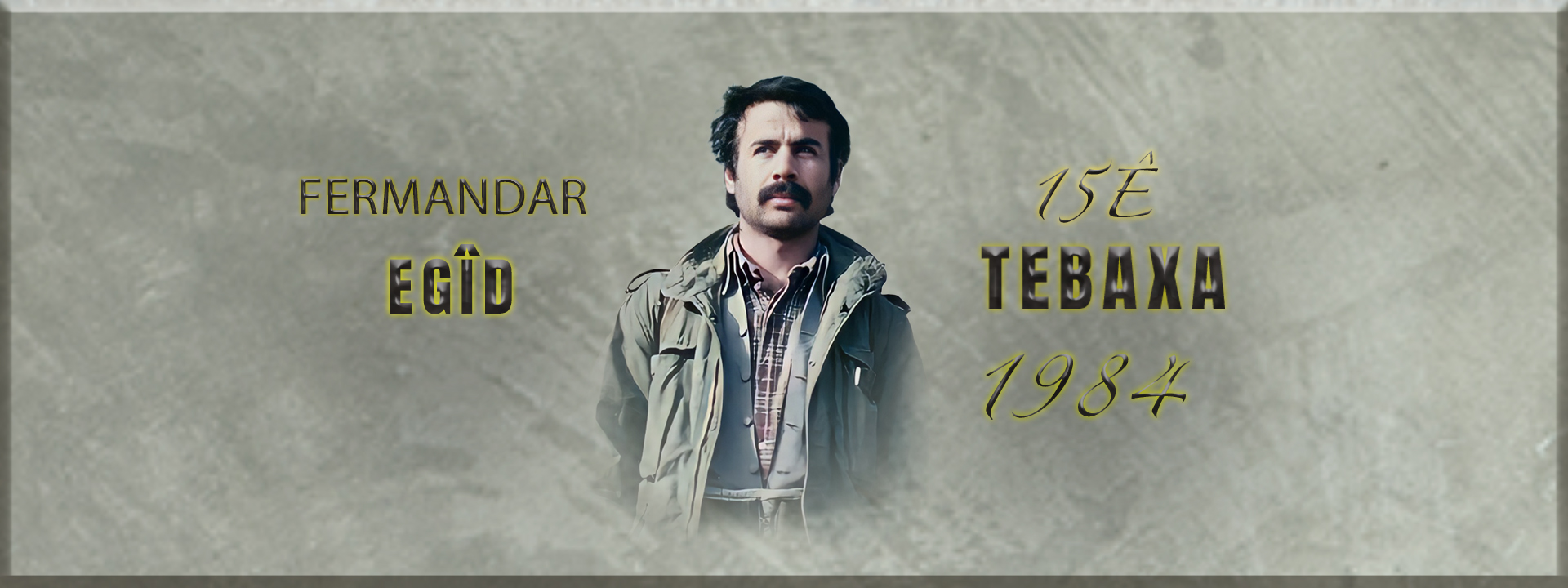Abdullah Öcalan liest die Geschichte der Menschheit als Kampf zwischen Staat und Kommune – als kontinuierlichen Ausdruck des Strebens nach Freiheit. Kommunen seien nur durch autonome, antikapitalistische Praxis dauerhaft realisierbar.
In seinen programmatischen Schriften – sowohl im „Manifest der demokratischen Zivilisation“ als auch im Manifest für Frieden und eine demokratische Gesellschaft – identifiziert Abdullah Öcalan die Kommune als grundlegend für die Befreiung der Menschheit. Historisch betrachtet stellen Kommunen die kleinsten und zugleich bedeutendsten Organisationsformen gemeinschaftlichen Lebens dar. Sie bilden jene Räume, in denen Menschen ihr Leben kollektiv gestalten und sich als Subjekte des sozialen Alltags selbst ausdrücken und artikulieren können.
Im Verlauf der Geschichte wurden kommunale Strukturen vielfach erprobt – insbesondere als konstitutives Element sozialistischer Bewegungen. Diese Organisationsform erweist sich als eine, die sich im Laufe der Zeit fortwährend weiterentwickelt hat, aus ihren eigenen Fehlern lernte und sich entsprechend erneuerte. Der Grund hierfür liegt in ihrer besonderen Qualität: Die Kommune ist Ausdruck des Lebens selbst – die ursprünglichste und zugleich adäquateste Form kollektiver Organisation.
Vor diesem Hintergrund rücken Kommunen, nicht zuletzt durch die Erneuerung ihrer Bedeutung in der Theorie Öcalans und durch die Praxis der kurdischen Befreiungsbewegung, erneut in den Fokus politischer Diskussionen. In einer Welt, die zunehmend durch ein global dominantes kapitalistisches System und durch ein auf liberaler Repräsentationslogik basierendes Demokratieverständnis geprägt ist, erscheinen Kommunen als reale Alternative und als möglicher Ausweg für die Gesellschaften dieser Welt.
Die Kommune als Fundament einer sozialistischen Gesellschaft
Vorausgesetzt, dass sie auf korrekte Weise organisiert und in ein kohärentes System eingebettet werden, stellen Kommunen einen entscheidenden Schritt im Prozess des sozialistischen Aufbaus dar. Zentral hierfür ist ein vertieftes historisches Verständnis sowie eine präzise konzeptionelle Erfassung und Definition kommunaler Strukturen. Orientiert man sich an den Bedingungen und Prinzipien, wie sie Öcalan im Rahmen seines neuen Paradigmas und im Manifest für Frieden und eine demokratische Gesellschaft formuliert, so kann eine kommunale Organisation als Brücke fungieren, über die die Völker mit der Idee des Sozialismus in Berührung kommen.
Öcalan selbst hat innerhalb der kurdischen Befreiungsbewegung über Jahrzehnte hinweg ein auf kontinuierlicher Reflexion und Erneuerung beruhendes Konzept kommunaler Selbstorganisation verfolgt. Besonders während der 1990er Jahre – einer Phase intensiver militärischer und politischer Auseinandersetzung – wurden in verschiedenen Wirkungsfeldern der Bewegung kommunale Strukturen erprobt. Dabei verstand man die Kommune nicht bloß als ökonomische Einheit, sondern als umfassendes Organisationsmodell für sämtliche Lebensbereiche.
Im Gegensatz zu klassischen linken und realsozialistischen Strömungen, die die Kommune oftmals auf ein rein wirtschaftliches Kollektiv reduzierten, vermied die kurdische Befreiungsbewegung konsequent diesen Fehler. Bereits in den 1990er Jahren begannen insbesondere in den Gefängnissen Prozesse der Kommunalisierung, durch welche das Alltagsleben der Inhaftierten – politischer Kader und Aktivist:innen – neu strukturiert wurde. Diese Versuche führten zu einem praxisnahen Modell, das schließlich als tragfähige Grundlage kommunalen Lebens innerhalb widrigster Bedingungen funktionierte.
Was ist eine Kommune – und was ist sie nicht?
In der Geschichte stand das staatliche Prinzip stets in einem antagonistischen Verhältnis zu jenen Strukturen, die dem Menschen ursprünglich zugehörig sind. Der Staat griff ein, überformte, vereinnahmte oder tilgte das, was nicht seiner Ordnung entsprach. Öcalans Bezug auf historische Kommunen ist insofern als Antwort auf diese Tendenz der Assimilation und Auslöschung zu verstehen. Denn die traditionelle Geschichtsschreibung – sowohl in der bürgerlichen als auch in Teilen der sozialistischen Theorie – interpretiert Geschichte primär als Abfolge von Klassenkämpfen und Staatsbildungen. Der Staat erscheint hier als historische Notwendigkeit und als Ursprung von Zivilisation.
In dieser Erzählung wird die vorstaatliche Gesellschaft abgewertet und als „primitiv“ klassifiziert – ein Narrativ, das auch in sozialistischen Denkmodellen tradiert wurde. Der Grund hierfür liegt darin, dass viele ideologische Systeme – selbst jene, die sich als staatskritisch verstehen – letztlich selbst auf Machterlangung und Staatsführung ausgerichtet sind.
Auch wenn zu Beginn revolutionärer Bewegungen die Aneignung staatlicher Macht als Fortschritt erscheinen mag, zeigen die historischen Erfahrungen, dass dies meist zur Formierung autoritärer Einheitsgesellschaften geführt hat. Wer immer die Macht innehat, prägt Gesellschaft nach seinen Vorstellungen – durch Ideologie, durch Repression, durch Ausschluss. Der staatliche Zwang zur Vereinheitlichung führt unabhängig von den ursprünglichen Intentionen aller Ideologien am Ende stets zur Etablierung totalitärer Systeme.
Die Delegitimierung der Kommune als staatliche Strategie
Gerade weil die Kommune ein Gegenentwurf zur staatlichen Ordnung darstellt, ist sie im Verlauf der Geschichte systematisch delegitimiert, marginalisiert oder vereinnahmt worden. Staaten versuchen grundsätzlich, alle Ansätze, die eine Alternative zu ihrer eigenen Herrschaftslogik bilden könnten, entweder zu zerstören oder in sich aufzulösen. In diesem Kontext ist auch die Diffamierung kommunaler Organisationsformen zu verstehen: Sie wurden häufig als Überbleibsel „primitiver“ Epochen klassifiziert – ein diskursiver Akt, der darauf abzielt, Räume kollektiver Selbstorganisation, in denen alle gesellschaftlichen Gruppen Platz finden könnten, zu delegitimieren.
Statt als emanzipatorisches Gesellschaftsmodell wird die Kommune vom hegemonialen System oftmals als „geschlossene Gruppierung“ dargestellt, die sich von gesellschaftlicher Entwicklung abgewendet habe – angelehnt an romantisierte Bilder vormoderner Stammesgesellschaften. In anderen Kontexten wiederum wird die Kommune reduziert auf eine Gemeinschaft von Personen „mit denselben Ansichten“. Gerade diese Definition birgt eine erhebliche Problematik: Sie impliziert Homogenität und schließt Differenz aus – was letztlich neue Formen der Spaltung, Ausgrenzung und Hierarchisierung innerhalb der Gesellschaft hervorruft.
Ein solches Verständnis findet sich auch heute noch in bestimmten institutionellen Strukturen wieder – etwa in Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbänden –, die ihre Organisationsform nach spezifischen Klassenzugehörigkeiten ausrichten. Selbst innerhalb sozialistischer Kontexte führt eine in Klassen oder Segmente aufgeteilte kommunale Struktur nicht zur Aufhebung von Hierarchien, sondern im Gegenteil: Sie reproduziert Ausschlüsse und befördert, wie Öcalan vielfach kritisierte, die Entstehung von „Kasten“ innerhalb der Gesellschaft. Die historische Praxis hat gezeigt, dass sozialistische Bewegungen, die solchen Segmentierungslogiken folgten, häufig an gesellschaftlicher Relevanz eingebüßt oder ihre Existenzgrundlage ganz verloren haben.
Die Begriffe „Kommune“ und „Kommunalität“ gehen etymologisch auf das lateinische „commūnis“ zurück, das „gemeinsam“ oder „allen gehörend“ bedeutet. Die Wurzel findet sich in vielen indoeuropäischen Sprachen und verweist auf die Idee einer Lebensform, die auf Gemeinsamkeit, Teilhabe und kollektivem Handeln basiert – ohne Herrschaft, ohne Klassen, ohne staatliche Zentralgewalt. Entscheidend ist dabei die Orientierung an den realen Bedürfnissen der Menschen sowie die Verwirklichung einer Lebensweise, in der sich jede:r entsprechend seiner Fähigkeiten einbringen kann. Der staatliche Diskurs jedoch begann bereits auf semantischer Ebene mit der Abwertung dieser Organisationsform – lange bevor sie praktisch gefährlich werden konnte.
Ohne Inklusivität keine Kommune
Ein Gemeinwesen, das sich nicht auf alle Teile der Gesellschaft erstreckt, verliert seinen kommunalen Charakter. Wenn sich Kommunen aus Spaltung oder Abgrenzung konstituieren, so führt dies – wie die historische Erfahrung zeigt – unweigerlich zu ihrem Scheitern. Diese Art von Fragmentierung widerspricht zudem zentralen Prinzipien der verhandelnden (deliberativen) Demokratie, wie sie Öcalan als Übergangsmodell hin zum Sozialismus versteht. Das Prinzip, demzufolge politische Entscheidungen nicht auf Mehrheitsverhältnissen, sondern auf gesellschaftlichem Konsens beruhen müssen, ist fundamental für jede kommunale Organisation.
In der kurdischen Befreiungsbewegung werden kommunale Strukturen nicht als Zusammenschluss Gleichdenkender verstanden, sondern als offene Räume, in denen Menschen ihre Meinungen frei äußern, diskutieren und gemeinsam Entscheidungen treffen können – ohne Hierarchie, ohne Repression. Anders als im realsozialistischen Modell entstehen diese Strukturen nicht durch Anweisung „von oben“ oder durch die Einsetzung von Funktionär:innen, sondern durch die Selbstorganisation der Menschen, die in einem bestimmten Gebiet leben und es gestalten wollen.
Abdullah Öcalan brachte dies in einem Gespräch aus dem Jahr 2010 prägnant auf den Punkt:
„Die grundlegende Aufgabe unseres Paradigmas muss es sein, das Volk von unten bis oben in Form von Kommunen zu organisieren. Dies sollte sich praktisch in der Lösung alltäglicher Probleme widerspiegeln. Nur auf diesem Wege lässt sich Sozialismus verwirklichen. Die Pariser Kommune war ein guter Anfang, wurde jedoch nicht richtig verstanden. Hätte sie Erfolg gehabt, wäre der von Marx angestrebte Sozialismus möglich gewesen. Doch später setzte sich die Vorstellung durch, Sozialismus könne nur mit Hilfe des Staates aufgebaut werden. Aber der Staat kann nicht sozialistisch sein – nur die Gesellschaft kann es.“
Kommunale Strukturen im historischen Verlauf – eine alternative Geschichtslesung
In seinem jüngsten Manifest schlägt Abdullah Öcalan vor, die Menschheitsgeschichte nicht entlang der klassischen Linie des Klassenkampfes, sondern vielmehr im Spannungsverhältnis zwischen Staat und Kommune zu lesen. Kommunale Organisationsformen, so argumentiert er, reichen bis in die frühesten Epochen menschlicher Zivilisation zurück. Diese Deutung stellt eine bewusste Abkehr von der marxistisch geprägten Geschichtserzählung dar, die die Menschheitsgeschichte als Abfolge ökonomisch fundierter Gesellschaftsformationen beschreibt – von der „Urgesellschaft“ über Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus und Kapitalismus bis hin zum Kommunismus.
Öcalans alternative Perspektive hat in der Öffentlichkeit intensive Debatten ausgelöst – und löst sie bis heute aus. Denn die Forderung, Geschichte nicht primär als Klassenkampf, sondern als Auseinandersetzung zwischen staatlicher Zentralmacht und kommunaler Selbstorganisation zu interpretieren, bedeutet zugleich, zentrale Narrative linker Theorie zu überdenken und neu zu schreiben. Insbesondere das marxistische Periodisierungsschema verliert in dieser Lesart seine Gültigkeit – mit weitreichenden theoretischen und politischen Konsequenzen.
Die Geschichte der Menschheit, so Öcalan, ist nicht nur eine Geschichte der Herrschaft, sondern auch eine Geschichte widerständiger kommunaler Versuche, sich gegen diese zu behaupten. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen kam es zur Etablierung des Staates, der sich als Instrument einer herrschenden Klasse durchsetzte – oft mit Gewalt, Repression und ideologischer Indoktrination. Trotz der kontinuierlichen Versuche von Staaten, kommunale Strukturen zu eliminieren oder zu vereinnahmen, haben diese immer wieder als Hoffnungsträger gewirkt. Sie blieben – unabhängig von ihren konkreten Ergebnissen – Ausdruck einer kollektiven Alternative zur bestehenden Ordnung.
Insbesondere im Nahen Osten lassen sich zahlreiche Beispiele für kommunale Bewegungen und auf kommunalistischen Ideen beruhende Aufstände finden. Prominent unter ihnen ist der Mazdak-Aufstand, dessen philosophische Grundlagen bis heute eine zentrale Referenz für kommunale Ansätze darstellen. Der zoroastrische Priester Mazdak vertrat bereits im 5. Jahrhundert n. Chr. Positionen, die in radikalem Kontrast zur herrschenden Ordnung standen: Gemeinsame Nutzung von Besitz und Reichtum, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Ablehnung jeglicher Herrschaft des Menschen über den Menschen.
In eine ähnliche Richtung ging die Bewegung der Hurufiyya, die einen naturbezogenen Weltzugang entwickelte und den Menschen als Teil eines größeren ökologischen Ganzen verstand. Diese Bewegung, die als Vorläufer mystisch-kommunalistischer Traditionen gilt, wurde – wie auch der Mazdakismus – gewaltsam unterdrückt. Viele ihrer Anhänger:innen mussten sich zerstreuen und im Verborgenen weiterexistieren. Weitere Bewegungen wie der Şeyh Bedreddin-Aufstand, die Revolte um Ismail Maşuki sowie die Kalandar-Bewegung trugen die gleiche Grundhaltung: einen kommunalistischen Widerstand gegen staatliche und klerikale Eliten.
Die Worte Şeyh Bedreddins – „Teilhaben an allem außer an der Wange der Geliebten“ – sowie Ismail Maşukis Frage – „Wenn wir alle aus der Erde kommen und zu ihr zurückkehren, warum seid ihr dann reicher als wir?“ – bringen diese soziale Kritik pointiert zum Ausdruck. Beide Bewegungen richteten sich gegen die Privilegien der herrschenden Klassen und standen für eine egalitäre, solidarische Gesellschaftsform.
Doch kommunale Experimente beschränken sich nicht auf den Nahen Osten. Weltweit haben Arbeiter:innen, Unterdrückte und Marginalisierte in verschiedenen Epochen versucht, sich in kommunalen Strukturen zu organisieren und ein kollektives Leben aufzubauen. Was viele dieser Versuche jedoch schwächte, war die Unterschätzung der staatlichen Gewalt. Anstatt ein System außerhalb des bestehenden zu etablieren, reproduzierten viele Kommunen unbewusst dessen Rahmenbedingungen – und erlagen schließlich.
Ob in der Pariser Kommune, in sowjetischen Rätestrukturen oder in kommunalistischen Bewegungen in Mexiko, Lateinamerika oder Afrika – das strukturelle Scheitern vieler dieser Initiativen verweist auf ein zentrales Problem: das fehlende Verständnis und die mangelnde Umsetzung eines staatsfernen, autonomen Gemeinwesens. Eine der größten Hürden lag in der Reproduktion des „staatsanalogischen Denkens“ – also in dem Versuch, dem Staat mit staatlichen Mitteln entgegenzutreten, anstatt ihn grundlegend zu dezentralisieren und zu ersetzen.
Zudem fehlte es vielen dieser Bewegungen an einer kohärenten Selbstverteidigungsstrategie gegenüber der Repression durch etablierte Machtapparate. Wo solche Mechanismen nicht aufgebaut wurden, scheiterten viele Kommunen trotz idealistischer Ansätze.
Die hier vorliegende Analyse versteht sich nicht als vollständige Geschichte kommunaler Bewegungen, sondern streift sie exemplarisch. Insbesondere im islamischen Kulturraum wurden viele kommunalistische Bewegungen diffamiert und aus dem kulturellen Gedächtnis gelöscht. Gruppen, die sich außerhalb der etablierten religiösen Ordnung positionierten, wurden häufig als Häretiker, Gottlose oder Ungläubige bezeichnet – ein weiteres Beispiel für die sprachliche und ideologische Delegitimierung widerständiger Strukturen.
Auswahl historischer kommunaler Erfahrungen:
Karmatiten – Naher Osten
Hurufiyya – Iran und Mesopotamien
Bewegung um Şeyh Bedreddin
Bewegung um Ismail Maşuki
Pariser Kommune
Katalanische Kantone – Spanien
Republik Strandscha – Osmanisches Reich
Magonistische Rebellion – Mexiko
Kommune von Morelos – Mexiko
Sowjetrepublik Naissaar – Estland
Sowjetrepublik Odessa – Ukraine
Machno-Bewegung – Ukraine
Bremer Räterepublik – Deutschland
Münchner (auch Bayerische) Räterepublik – Deutschland
Limerick Sowjet – Irland
Patagonien-Aufstand – Argentinie
Bauernaufstand von Tambow – Russland
Kronstädter Aufstand – Russland
Kommune von Guangzhou – China
Präfektur Shinmin – China
Katalonien-Revolution – Spanien
Rat von Asturien und León – Spanien
Nationale Arbeiterkonföderation (CNT) – Spanien
Volksrepublik Korea – Nordkorea
Kommune von Saigon – Vietnam
Shanghaier Volkskommune – China
Horizontalidad-Bewegung – Argentinien
Kommune von Oaxaca – Mexiko
Symphony Way – Südafrika
15M-Bewegung – Spanien
Gezi-Park-Kommune – Türkei
Autonome Zone Capitol Hill – USA
Fortsetzung folgt in Teil 2 der Artikelreihe