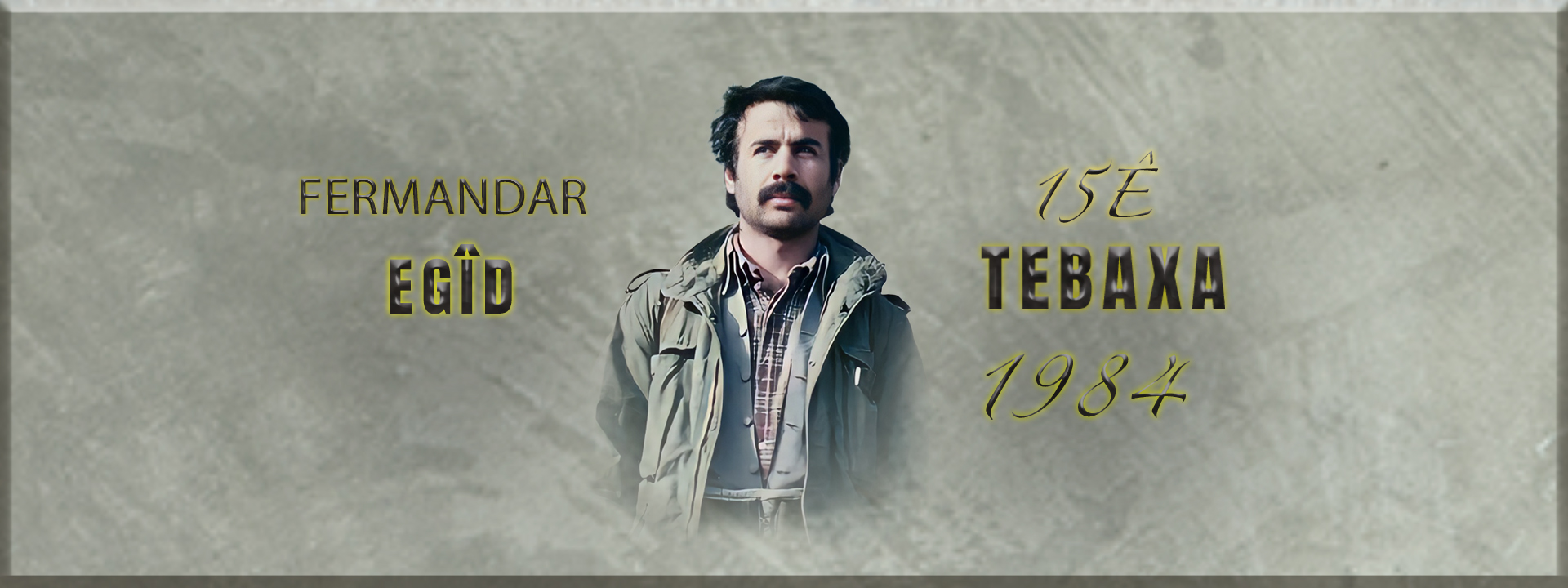Die Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung ist zugleich eine Geschichte der kommunalen Selbstorganisierung. Mit der Gründung der ERNK im Jahr 1985 begann ihr bislang weitreichendster Versuch, kollektive Lebensformen in der Gesellschaft zu verankern.
Die kurdische Befreiungsbewegung begann insbesondere in den 1990er Jahren, das Konzept der Kommune intensiver zu diskutieren und erste praktische Ansätze umzusetzen. Zwar lässt sich nicht behaupten, dass bis dahin keinerlei kommunales Denken existiert hätte, jedoch nahm die tatsächliche Praxis der Kommunalisierung – verstanden als ein Prozess der Verankerung in der Bevölkerung und der Annäherung der Bewegung an die gesellschaftliche Basis – in dieser Dekade erheblich an Dynamik zu.
Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung der Anfangsphase, die auf dem Modell einer Partei-Front-Struktur beruhte, war zunächst eine Frontorganisation aufgebaut worden. Die in der Praxis gemachten Erfahrungen zeigten jedoch bald, dass eine solche Organisationsform weit über die ursprünglich gedachten Funktionen hinausgehen konnte. Vor diesem Hintergrund rückte seit Beginn der 1990er Jahre die Frage ins Zentrum, inwieweit kommunale und räteartige Organisationsformen zur Stärkung des Befreiungskampfes beitragen könnten. In verschiedenen von der Bewegung veröffentlichten Materialien aus jener Zeit wurden Aufbau, Funktion und Notwendigkeit von Kommunen und Räten im kurdischen Kontext ausführlich thematisiert und reflektiert.
Obgleich die Bewegung ihrem Wesen nach stets einen kommunalen Charakter trug, begannen konkrete kommunale Strukturen – also die praktische Umsetzung dieser Perspektive – zuerst in den Gefängnissen. Angesichts der tausenden politischen Gefangenen wurde dort ein kommunales Organisationsmodell als Ausdruck gemeinschaftlichen Lebens eingeführt. Es ging dabei nicht nur um die Kader der PKK oder ihre Kämpfer:innen, sondern auch um Milizionär:innen und patriotisch gesinnte Kurd:innen, die inhaftiert waren. Durch die Bildung von Kommunen, welche auf die spezifischen Bedingungen der Haftanstalten Rücksicht nahmen und über die eigenen Regelwerke hinausgingen, etablierte die Bewegung zugleich eine Tradition der ortsgebundenen, pragmatischen Problemlösung.
Eine bewusste Abweichung von gängigen Definitionen der Kommune
Der Begriff „Kommune“ in der kurdischen Befreiungsbewegung unterscheidet sich wesentlich von klassischen Definitionen. Die Kommune stellt hier weniger ein Organ dar, das die Regeln zentraler Verwaltungsstrukturen umsetzt, sondern vielmehr eine Struktur, die aus ihren lokalen Gegebenheiten heraus eigenständig agiert und auf der strategischen Linie der Bewegung basiert. Abdullah Öcalans folgende Aussage bringt den Stellenwert dieses Verständnisses prägnant auf den Punkt:
„Wie der demokratische Föderalismus und die demokratische Autonomie die politische Organisationsform und Institutionalisierung der demokratischen Nation darstellen, so ist die Föderation kommunaler Wirtschaftsverbünde die Organisations- und Institutionalisierungsform des wirtschaftlichen Lebens. Die Föderation kommunaler Wirtschaftsverbünde bildet die ökonomische Grundlage der Gemeinschaft der demokratischen Nationen des Mittleren Ostens auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene.“
Die kommunalen Organisationsformen der Bewegung breiteten sich ausgehend von den Gefängnissen auf sämtliche gesellschaftlichen Bereiche aus. Gegen Ende der 1990er Jahre waren Volksräte und Kommunen – trotz bestehender Mängel und Fehler – in nahezu allen Regionen Kurdistans funktional geworden. Besonders in Nordkurdistan, wo der Krieg mit größter Härte geführt wurde, förderten die aufgebauten Volksräte die umfassende Beteiligung der Bevölkerung am Widerstand und führten zu einer signifikanten Ausweitung der Bewegung.
Ein entscheidender Schritt in diesem Prozess war die Entwicklung eines Sprach- und Handlungsansatzes, der auf die Glaubenswelt, Kultur und Tradition der Bevölkerung einging und somit eine niedrigschwellige Vermittlung der Ziele der Bewegung ermöglichte.
Obwohl dieser Ansatz insbesondere von türkischen und kurdischstämmigen linken Gruppen teils scharf kritisiert und als „Volkspopulismus“ abgewertet wurde, stellte er faktisch den entscheidenden Durchbruch im Prozess der Verankerung in der Bevölkerung dar. Die kurdische Gesellschaft, die gegenüber bevormundenden, belehrenden und kolonialen Ansätzen stets distanziert geblieben war, reagierte offen und mit Zustimmung auf den Ansatz der Freiheitsbewegung Kurdistans, die sie als eine Bewegung aus ihrer eigenen Mitte wahrnahm.
Ein prägnantes Beispiel für die Verankerung und kommunale Organisierung in dieser Zeit bildeten die Trauer- und Beisetzungsrituale für gefallene Guerillakämpfer:innen. Die lokalen Strukturen der PKK organisierten diese Prozesse im bewussten Gegensatz zu sozialistischen und revolutionären Bewegungen, die religiöse Bedürfnisse der Bevölkerung oft ignorierten. Die organisierte Rücksichtnahme auf religiöse Praktiken führte dazu, dass die Trauerfeiern große gesellschaftliche Resonanz erfuhren und die Teilnahme an den Begräbnissen zu Massenereignissen wurde – stets in Würdigung der religiösen und kulturellen Empfindsamkeiten der Bevölkerung.
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie der in jener Zeit entstehende und sich verbreitende Prozess der Nationalen Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) – als kommunale Praxis der kurdischen Freiheitsbewegung – gesellschaftliche Verankerung und breite Akzeptanz fand.
Kommunale Experimente in den Gefängnissen
Die ersten kommunalen Organisationsansätze innerhalb der kurdischen Bewegung begannen gegen Ende der 1980er Jahre in den Gefängnissen des türkischen Staates Gestalt anzunehmen. Zwar hatte sich bereits zuvor eine Kultur des Miteinanders und der kollektiven Lebensweise herausgebildet, jedoch war eine strukturierte kommunale Organisierung im engeren Sinne noch nicht umgesetzt worden. Erst ab dem Ende der 1980er Jahre wandte sich die Bewegung systematisch der kommunalen Aufbauarbeit innerhalb der Haftanstalten zu.
Vor allem infolge der massiven staatlichen Repression, in deren Verlauf nicht nur Kader der PKK, sondern auch Sympathisant:innen und patriotische Kurd:innen inhaftiert wurden, entstand die Notwendigkeit eines neuen organisatorischen Modells. Die Anwendung des Kommunensystems unter diesen Bedingungen erwies sich bald als richtiger Schritt der Bewegung. In Gefängnissen, in denen politische Kader und patriotisch gesinnte Bevölkerungsteile gemeinsam inhaftiert waren, konnte mithilfe kommunaler Strukturen den Angriffen des Staates, den Versuchen zur Agentenrekrutierung und der Demoralisierung entgegengewirkt werden. Der Gedanke des Widerstands blieb auf diese Weise bis heute lebendig.
Ein zentrales Anliegen dieser kommunalen Praxis war es zudem, der inhaftierten Bevölkerung, die oftmals allein aufgrund ihrer kurdischen Identität oder ihrer Sympathie für die kurdische Freiheitsbewegung verhaftet worden war, die Ziele und Hintergründe des Kampfes zu vermitteln. Es sollte verständlich gemacht werden, warum solche Opfer gebracht wurden und wie eine alternative, gerechte Gesellschaft aussehen könnte. Diese Bildungs- und Bewusstseinsarbeit trug wesentlich zum Wachstum der Bewegung bei.
Darüber hinaus waren es auch die Kommunikationsformen mit den Angehörigen – insbesondere mit jenen, deren Kinder oder Ehepartner:innen inhaftiert waren –, die einen nachhaltigen Einfluss auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt hatten. Der Aufbau von Dialogen, das Bemühen um stete Verbindung nach außen und die Praxis, Angehörige nicht zu isolieren, sind wesentliche Faktoren für die heutige Verankerung des kurdischen Freiheitskampfes. Die nach den Prinzipien der Bewegung aufgebauten Gefängniskommunen haben somit bis heute dazu beigetragen, dass Haltung und Willen der Bewegung fortbestehen – in Form eines Systems, das Widerstand und gesellschaftliche Organisierung miteinander vereint.
ERNK als erste große kommunale Erfahrung in Kurdistan
Die Eniya Rizgariya Neteweyî ya Kurdistanê (ERNK) wurde im Rahmen des Newroz-Festes 1985 gegründet. Sie orientierte sich an der zu jener Zeit strategisch verfolgten Partei-Front-Linie der kurdischen Befreiungsbewegung. Von ihrer Gründung bis zu ihrer Selbstauflösung im Jahr 2000 war die ERNK nicht nur eine politische Struktur, sondern auch ein Instrument zur Lösung vielfältiger gesellschaftlicher Probleme – einschließlich jener des alltäglichen Lebens. Sie prägte die Reorganisation des ökonomischen, sozialen und kulturellen Lebens der Bevölkerung auf der Grundlage der ideologischen Prinzipien der Bewegung und schrieb sich damit in goldenen Lettern in die Geschichte des kurdischen Freiheitskampfes ein.
Was die ERNK im Vergleich zu anderen kurdischen Organisationen herausragen ließ, war ihr Ansatz, gesellschaftliche Probleme gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu diskutieren und die Grundlagen eines neuen Lebens gemeinsam mit der Bevölkerung zu schaffen. In diesem Sinne stellt die ERNK die erste umfassende kommunale Organisationsform dar, die von der kurdischen Bewegung landesweit umgesetzt wurde.
Das kurdische Volk war über Generationen hinweg entrechtet, systematisch marginalisiert und gezwungen, innerhalb von Grenzen zu leben, die stets von jenen gezogen wurden, die an der Macht waren. Massaker und systematische Gewalt prägten die kollektive Erfahrung. In den 1970er Jahren begann schließlich der entschlossene Kampf für die Wiederaneignung der eigenen Rechte.
Dieser Prozess wurde zunächst sowohl vom Staat als auch von Teilen der Opposition als unbedeutend eingeschätzt – man erwartete, dass er schnell wieder zerschlagen würde. Doch das Gegenteil trat ein: Anstelle der Vernichtung etablierte sich eine neue Realität, in der eine revolutionäre Organisation gemeinsam mit dem Volk zur Trägerin eines grundlegenden Wandels wurde – und zum neuen Hoffnungsträger für den Sozialismus weltweit.
Unter der Führung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) setzte das kurdische Volk seinen Weg fort – unter großen Opfern, aber gleichzeitig mit bedeutenden Beiträgen zur globalen Geschichte des Widerstands und revolutionärer Bewegungen. Eine dieser Errungenschaften war die fundamentale Umdeutung und Rückbesinnung auf das Wesen kommunaler Organisation – eine Umdeutung, die der Weltgesellschaft neue Hoffnung auf Selbstverwaltung und Solidarität vermittelte.
Aus dieser Perspektive betrachtet war die ERNK – trotz aller Unvollkommenheiten – eine einzigartige kommunale Erfahrung eines zersplitterten Volkes, für die es weltweit kein vergleichbares Beispiel gibt. Sie existierte 15 Jahre lang als kommunale Organisationsstruktur der kurdischen Freiheitsbewegung, bevor sie sich im Jahr 2000 im Zuge eines ideologischen Wandels der Bewegung auflöste und einer neuen Form der Organisierung Platz machte.
Die ERNK-Zeit markierte somit den Beginn einer neuen Phase innerhalb des kurdischen Freiheitskampfes. In dieser Phase wurde erkannt, dass bewaffneter Kampf und ideologische Positionen allein nicht ausreichen würden. Vielmehr wurde die tiefgreifende Einsicht gewonnen, dass eine wirkliche Verankerung in der Bevölkerung sowie die aktive Aneignung durch das Volk selbst fundamentale Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg sind.
Die ERNK übernahm in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle dabei, der Bevölkerung nicht nur die Botschaften der Bewegung zu vermitteln, sondern auch konkrete Hoffnung auf Befreiung zu geben. Und sie tat dies durch den Aufbau von Volksräten und kommunalen Strukturen, die den Weg zur Selbstverwaltung und Emanzipation in Kurdistan aufzeigten.
Als Abdullah Öcalan Mitte der 1990er Jahre erklärte: „Die Wiederauferstehung ist vollzogen – nun folgt die Befreiung“, fasste er damit exakt jenen Zustand zusammen: Ein Volk, das unter schwersten Repressionen lebte und gleichsam „sieben Stockwerke unter der Erde“ begraben war, konnte nur durch eine neue, auf seine Lebensrealitäten zugeschnittene Organisationsform wiederaufstehen – und genau das geschah in der Phase der ERNK.
ERNK: Ein entscheidender Schritt zur gesellschaftlichen Verankerung
In der Praxis zeigte sich die ERNK keineswegs nur als eine Milizorganisation oder als Struktur zur Rekrutierung von Kämpfer:innen für den bewaffneten Arm der Bewegung. Vielmehr war sie eine Organisation, die sich mit den Alltagsproblemen der Bevölkerung befasste und praktische Lösungen entwickelte. In Kurdistan, in der Türkei und in der gesamten Diaspora wandte sich die kurdische Bevölkerung bei ungelösten Problemen an die ERNK und bat um Unterstützung. Durch ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Probleme zu lösen, und die anschließenden Bemühungen, das alltägliche Leben neu zu ordnen und zu organisieren, wurde die ERNK zur ersten umfassenden kommunalen Erfahrung des kurdischen Volkes und Kurdistans.
Bis zu ihrer Auflösung, die im Zuge eines strategischen Wandels der Bewegung erfolgte, entwickelte die ERNK Mechanismen zur Lösung tausender Konflikte. Selbst alltägliche Streitigkeiten zwischen Nachbar:innen wurden durch gemeinschaftliche Vermittlung beigelegt. Sie vermittelte Vorstellungen eines neuen Lebens, klärte die Bevölkerung auf und band sie in Entscheidungsprozesse ein. Diese Praxis verschaffte der ERNK große Anerkennung und Vertrauen innerhalb der Gesellschaft.
Die von der ERNK geschaffenen Strukturen beruhten darauf, in lokalen Konflikten die Stimme angesehener Menschen einzubeziehen, sie in Prozesse der Entscheidungsfindung zu integrieren und bei größeren Auseinandersetzungen sogenannte Volksgerichte einzurichten. Diese Form der demokratischen Beteiligung prägte das gesellschaftliche Leben so tiefgreifend, dass bis heute tausende Kurd:innen ihren Alltag auf den Prinzipien und Erfahrungen dieser Zeit aufbauen.
Auch in Bereichen wie Hochzeiten und Trauerritualen – Orte, an denen sich kollektive Identität und Tradition besonders verdichten – entwickelte die ERNK Formen der Organisierung, die auf den Empfindlichkeiten der Bevölkerung basierten. Jeder gesellschaftliche Bereich wurde als ein Raum des Kampfes um ein neues Leben verstanden. Die ERNK bemühte sich kontinuierlich darum, die Bevölkerung zu informieren und in die Vision eines alternativen gesellschaftlichen Lebens einzuführen. Damit leistete sie einen entscheidenden Beitrag zur Herausbildung der heutigen kurdischen Freiheitsbewegung.
Die Umwandlung von Trauerfeiern in Räume kollektiver Organisierun
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese gesellschaftliche Verankerung war der Umgang mit den Beisetzungen von gefallenen Guerillakämpfer:innen in den 1990er Jahren. Die kurdische Bewegung entwickelte einen neuen Ansatz, der sich deutlich von bisherigen türkischen und kurdisch-linken Organisationen unterschied: Die Bevölkerung sollte die Trauerfeiern aktiv mittragen. Dies konterkarierte gezielt die speziellen psychologischen Kriegsmethoden, mit denen der Staat versuchte, eine Trennung zwischen Guerilla und Gesellschaft zu erzeugen.
In einer Zeit, in der der Staat die Verbindungen zwischen Bevölkerung und Bewegung durch diskriminierende Narrative wie „Das sind Armenier“, „Das sind Aleviten“ oder „Diese sind unbeschnitten“ zu unterbinden versuchte, legte die Bewegung großen Wert darauf, dass die Beisetzungen entsprechend der religiösen Überzeugungen der Bevölkerung erfolgten. Dies trug maßgeblich dazu bei, die Beziehung der Bevölkerung zum Befreiungskampf zu stärken.
In den 1990er Jahren wurden zahlreiche Guerillakämpfer:innen – selbst wenn ihre Identitäten unbekannt waren – durch kollektive Beisetzungen nach religiösen Riten würdevoll bestattet, und es wurden ihnen Gräber errichtet. Der respektvolle Umgang mit den Trauerritualen sorgte für eine intensive gesellschaftliche Bindung an die Bewegung. Diese Praxis wirkt bis heute nach: Bei manchen Beisetzungen werden nicht mehr die staatlichen Imame hinzugezogen, sondern religiös anerkannte Personen aus dem Kreis der Bevölkerung selbst, die von der Gemeinschaft als „fromm“ angesehen werden.
Ein bleibendes Vermächtnis kommunaler Organisierung
Trotz ihrer Mängel und Fehler ist die ERNK als erste große kommunale Struktur Kurdistans in die Geschichte eingegangen. In dieser Phase begann das kurdische Volk, sich seiner eigenen Werte bewusster zu werden. Es entwickelte, als eine Form des zivilen Ungehorsams gegen die vom System verordneten Auslöschungsstrategien, eine tiefe Verbundenheit mit der eigenen Kultur. Die Gesellschaft übernahm das neue Lebensverständnis der Freiheitsbewegung und überführte es in die eigene Alltagspraxis.
Das kurdische Volk entwickelte ein kollektives Bewusstsein, in dem Konflikte in selbst geschaffenen Räten gelöst, selbst Schuld- und Vermögensfragen ohne staatliche Instanzen geregelt und neue Lebensweisen an die nächste Generation vermittelt wurden. Die kurdische Sprache und Kunst erfuhren in dieser Zeit entscheidende Impulse und Weiterentwicklungen.
In den 1990er Jahren – der Hochphase der ERNK – fand das kurdische Volk zu sich selbst zurück und bekannte sich zu seiner Identität in all ihren Facetten. In dieser Zeit wurden weitere kommunale Institutionen aufgebaut: das Kurdische Institut, das Kulturzentrum Mesopotamien sowie der kurdische Fernsehsender MED TV, der aus dem Ausland sendete. Der Aufbau von MED TV war selbst ein Beispiel kommunaler Selbstorganisation unter Bedingungen staatlicher Repression.
Obwohl der Staat vehement versuchte, das Zuschauen zu unterbinden, sorgten lokale Strukturen der Freiheitsbewegung dafür, dass der Sender in ganz Kurdistan empfangen werden konnte. In vielen Orten wurden sogar Satellitenschüsseln beschafft, damit Haushalte Zugang erhielten – teils wurden technische Hilfen beim Einrichten des Senders geleistet. Einige Personen wurden wegen dieser Aktivitäten verhaftet und verbrachten Jahre in Haft.
Wenn heute die kurdische Sprache weltweit gesprochen, kurdische Kunst frei ausgeübt und traditionelle kurdische Kleidung und Bräuche öffentlich sichtbar gelebt werden können, dann ist dies der ERNK zu verdanken – jener ersten großen kommunalen Bewegung, die 1985 gegründet wurde und über 15 Jahre hinweg dem kurdischen Volk eine neue Lebensweise vermittelte.
Diese Praxis belegt, dass das kommunale Denken und Handeln der kurdischen Freiheitsbewegung kein zufälliges Ergebnis war, sondern auf einer langen und konsequenten Entwicklung basierte. Gleichzeitig widerlegt sie jene Stimmen, die behaupteten, ein solcher Ansatz könne in Kurdistan keinen Erfolg haben – im Gegenteil: Sie zeigt, dass mit der richtigen Herangehensweise große gesellschaftliche Fortschritte möglich sind.
Fortsetzung folgt in Teil 4 der Artikelreihe